26. Sep 2025
|
Wirtschaft
Europa zwischen den Fronten – wie digitale Souveränität zum Überlebensfaktor wird – mit Dr. Ralf Wintergerst
Journalist: Thomas Soltau
|
Foto: Presse, Panumas Nikhomkhai/pexels
Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst erklärt, warum Europa im Tech-Dreikampf mit USA und China nur dann mithalten kann, wenn es endlich mutiger, schneller und unabhängiger handelt.
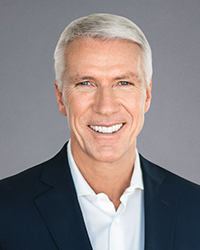
Dr. Ralf Wintergerst, Präsident bitkom e. V.
Der Begriff „digitale Souveränität“ macht gerade in Berlin und Brüssel Karriere. Angesichts der aktuellen Tech-Rivalität zwischen den USA und China – was verstehen Sie konkret darunter, und warum ist digitale Souveränität für Deutschland und Europa plötzlich so wichtig? Digitale Souveränität bedeutet die Fähigkeit, im digitalen Raum selbstbestimmt zu handeln – mit eigenen Spitzentechnologien, Infrastruktur und Kompetenz –, ohne einseitige Abhängigkeiten. Gerade in Zeiten wachsender Tech-Rivalität ist sie essenziell, um wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und demokratische Kontrolle zu sichern.
Steckt Europa in einem digitalen Sandwich zwischen den Tech-Supermächten USA und China? Wie kann die EU eigene Akzente setzen und diesem Spagat entkommen, statt dauerhaft zwischen Washington und Peking zerrieben zu werden? Europa muss die eigene digitale Souveränität durch strategische Investitionen in Schlüsselbereiche wie KI, Quantencomputing, Cloud-Infrastrukturen, Mikroelektronik und IT-Sicherheit stärken. Gleichzeitig braucht es schnellere Genehmigungen, einheitliche Standards und einen drastischen Abbau von Regulierung.
China treibt mit Initiativen wie „Made in China 2025“ energisch die eigene technologische Autarkie voran. Müssen wir in Europa neidisch oder nervös nach Peking blicken? China macht vor, wie von oben gesteuerte Technologiepolitik gestaltet werden kann. Europa sollte aufmerksam, aber nicht nervös hinschauen. Statt auf Regulierung und zentrale Steuerung zu fokussieren, müssen wir auf offene Märkte und Wettbewerb setzen. Wichtig ist: Wir brauchen eine starke Digitalstrategie – europäisch, wertebasiert und zukunftsgerichtet. Für die Bundesregierung gilt: Sie muss die Wirtschaft in den Mittelpunkt der Politik stellen und digitale Souveränität zum Top-Thema machen.
Amerikanische Tech-Giganten dominieren unseren digitalen Alltag. Kann Europa überhaupt souverän sein, solange wir kaum an Google, Apple & Co. vorbeikommen? Brauchen wir eigene Big Player, oder ist Koexistenz mit den Silicon-Valley-Platzhirschen der einzig realistische Weg? Digitale Souveränität heißt nicht Abschottung. Europa wird immer auf strategische Partner angewiesen sein. Europa braucht aber auch eigene starke Anbieter in Schlüsseltechnologien und damit weltweit einzigartige Fähigkeiten, die wir im Bedarfsfall in die Waagschale werfen können – beispielsweise im Quantum Computing, bei autonomen Systemen oder in der digitalen Medizin. Partnerschaft und Wettbewerb schließen sich nicht aus. Beides muss Hand in Hand gehen.
Deutschland und die EU lancieren Projekte wie GAIA-X für eine europäische Cloud oder investieren mit dem EU Chips Act in eigene Halbleiter-Fabriken. Sind das aus Ihrer Sicht echte Game-Changer auf dem Weg zur digitalen Souveränität – oder eher Wolkenschlösser in der Cloud? Gaia-X und der EU Chips Act sind wichtige Bausteine für digitale Souveränität. Entscheidend wird sein, ob sie marktfähige Lösungen liefern, internationale Partner einbinden und Innovation beschleunigen. Erfolg misst sich daran, ob Unternehmen in Europa leistungsfähige, wettbewerbsfähige Alternativen anbieten können.
Digitale Souveränität ist kein Luxus, sondern eine Investition in Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Kurzfristig entstehen Kosten, langfristig sichern eigene Technologien Wertschöpfung, Innovationskraft und Unabhängigkeit.
Digitale Souveränität hat auch ein Preisschild. Eigene Infrastruktur, eigene Technologie aufzubauen, ist teuer und aufwendig. Ist das ein Luxusprojekt, das Europa sich aus strategischen Gründen gönnen muss, oder rechnet sich digitale Unabhängigkeit langfristig sogar ökonomisch? Digitale Souveränität ist kein Luxus, sondern eine Investition in Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Kurzfristig entstehen Kosten, langfristig sichern eigene Technologien Wertschöpfung, Innovationskraft und Unabhängigkeit. So bleiben wir global konkurrenzfähig – und stärken zugleich Europas wirtschaftliche Zukunft. Wettbewerbsfähigkeit wird nicht durch mehr Regulierung erzeugt!
In politischen Reden ist digitale Souveränität längst ein Dauerbrenner. Aber folgt den vielen Worten auch konkretes Handeln? Was muss die Politik in Berlin und Brüssel tun, damit aus dem Buzzword „digitale Souveränität“ greifbare Realität wird – bevor wir uns in Strategiepapieren verlieren? Berlin und Brüssel müssen Strategien in konkrete Projekte, gezielte Investitionen und deutlich schnellere Genehmigungsverfahren überführen. Entscheidend sind klare Zuständigkeiten sowie verbindliche Zeitpläne für die Umsetzung. Zudem brauchen wir einheitliche, europäische Standards, die Innovation fördern und Wettbewerb ermöglichen. Die gezielte Förderung von Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Infrastrukturen, Halbleitern und Quantencomputing muss Priorität haben. Digitale Souveränität entsteht nicht auf dem Papier, sondern durch entschlossenes Handeln und nachhaltige Umsetzung. Und: Prioritäten einhalten.
Zum Abschluss – werden wir Ihrer Einschätzung nach eines Tages einen „Digital Independence Day“ in Europa feiern können? Oder bleibt das eine Illusion, während wir weiterhin brav auf iPhones tippen und durch TikTok scrollen? Ein „Digital Independence Day“ ist kein Zielpunkt, sondern ein Prozess. Wir werden weiter globale Plattformen nutzen – aber ergänzt durch starke europäische Technologien und Infrastruktur. Digitale Souveränität heißt Wahlfreiheit und Selbstbestimmung. Daran können wir Schritt für Schritt arbeiten. Klar ist: Die Stärkung unserer digitalen Souveränität wird über unsere künftige Wettbewerbs- und Widerstandsfähigkeit und damit über unseren Wohlstand und unsere Sicherheit entscheiden.








